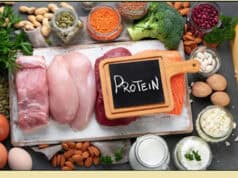Herzinfarkte bei Frauen: Warum sie noch immer benachteiligt sind – und was sich langsam verändert
Ein Herzinfarkt gehört zu den medizinischen Notfällen, bei denen Sekunden über Leben und Tod entscheiden können. Doch Frauen haben in Deutschland und weltweit schlechtere Chancen, rechtzeitig erkannt und behandelt zu werden. Das zeigt eine groß angelegte Studie, die fast 30.000 Fälle auswertete und von Forscherinnen und Forschern der Universität Sydney durchgeführt wurde.
Die Ergebnisse sind ein zweischneidiges Schwert: Zwar wird die Versorgung besser – für Männer wie für Frauen. Aber während die Fortschritte bei Frauen etwas schneller vorangehen, bleibt der Abstand groß. Von wirklicher Gleichbehandlung sind wir noch weit entfernt.
Fast 30.000 Fälle unter der Lupe
Die Untersuchung umfasste die Krankenakten von 29.435 Patientinnen und Patienten, die zwischen 2011 und 2020 einen STEMI-Herzinfarkt erlitten. Diese Form – ein kompletter Verschluss einer Herzarterie – macht etwa ein Viertel aller Herzinfarkte aus und gilt als besonders gefährlich. Der Befund ist klar auf dem EKG sichtbar, die Diagnose eigentlich eindeutig. Trotzdem zeigen die Daten, dass Frauen häufiger schlechtere Chancen haben.
Die leitende Studienautorin, Kardiologin Professorin Clara Chow vom Westmead Hospital, bringt es auf den Punkt: „Unsere Analyse zeigt, dass sich die Ergebnisse für beide Geschlechter verbessern – und bei Frauen sogar etwas schneller. Aber die Lücke ist immer noch groß. Wenn es so weitergeht, wird es mehr als ein Jahrzehnt dauern, bis Gleichheit erreicht ist.“
Seltener die richtigen Eingriffe
Frauen, die einen Herzinfarkt erleiden, haben laut Studie 13 Prozent geringere Chancen auf eine Angiografie, also eine Untersuchung der Herzkranzgefäße. Noch deutlicher ist der Unterschied bei lebensrettenden Eingriffen wie der perkutanen Koronarintervention (PCI), bei der Gefäße wieder geöffnet und Stents gesetzt werden: Hier liegt die Wahrscheinlichkeit für Frauen 16 Prozent niedriger.
Gerade diese Verfahren sind entscheidend, um den Blutfluss wiederherzustellen und bleibende Schäden am Herzmuskel zu verhindern. Jeder Zeitverlust kostet Herzgewebe – und kann im schlimmsten Fall das Leben.
Wenn Symptome nicht in das Schema passen
Warum aber haben Frauen schlechtere Chancen? Ein zentraler Grund: Ihre Symptome sehen oft anders aus als die der Männer.
Während Männer meist unter dem typischen Brustschmerz leiden, äußert sich ein Herzinfarkt bei Frauen häufig unspezifischer – durch Atemnot, Druckgefühl im Oberbauch, ungewöhnliche Müdigkeit oder Schwindel.
„Diese Unterschiede führen dazu, dass Betroffene ihre Beschwerden nicht sofort ernst nehmen – und auch Ärzte und Ärztinnen manchmal zu spät reagieren“, erklärt Professorin Chow. „Ich sehe in meiner Praxis immer noch unbewusste Vorurteile, die die Behandlung verzögern.“
Das tödliche Risiko der Diagnose-Verzögerung
Die Folge dieser Verzögerungen ist gravierend: Frauen haben nach einem Herzinfarkt sechs Prozent höhere Sterblichkeitsraten innerhalb des ersten Jahres als Männer – selbst wenn Faktoren wie Diabetes, Demenz oder Herzschwäche berücksichtigt werden.
Auch die Rate schwerer Folgeereignisse wie Schlaganfälle liegt höher. Das unterstreicht, wie stark die unterschiedlichen Symptome und die verzögerte Versorgung das Überleben beeinflussen.
Positive Entwicklungen – aber langsam
Es gibt jedoch auch Hoffnung: Die Studie zeigt, dass die Sterblichkeitsrate insgesamt sinkt – und zwar bei Frauen etwas schneller als bei Männern. Auch die Zahl schwerer Folgekomplikationen nimmt ab.
Zudem steigt die Nutzung moderner Verfahren wie Angiografie und PCI bei Frauen inzwischen schneller an als bei Männern. Das deutet darauf hin, dass die Sensibilität für das Thema wächst und Aufklärungskampagnen über die speziellen Symptome von Frauen Wirkung zeigen.
„Die gute Nachricht ist, dass die Botschaft ankommt“, sagt Chow. „Aber die Geschwindigkeit ist einfach zu niedrig. Wir brauchen mehr Aufmerksamkeit und mehr Training, um die Unterschiede schneller zu verringern.“
Warum Frauen besonders gefährdet sind
Die schlechteren Ergebnisse bei Frauen sind nicht nur auf die Medizin zurückzuführen. Frauen sind bei ihrem ersten Herzinfarkt oft älter als Männer und leiden häufiger unter zusätzlichen Erkrankungen wie Diabetes oder Herzinsuffizienz. Diese erschweren die Diagnose und machen Behandlungen riskanter.
Hinzu kommt, dass viele Frauen ihre Symptome selbst unterschätzen – oft aus dem Gedanken heraus, dass sie „nur gestresst“ oder „übermüdet“ seien. Auch gesellschaftliche Rollenbilder spielen hinein: Frauen kümmern sich oft zuerst um andere, bevor sie sich selbst ärztliche Hilfe suchen.
Andere Faktoren im Spiel?
Nicht alle Forscher sind überzeugt, dass die bessere Entwicklung bei Frauen nur auf Fortschritte in der Herzmedizin zurückzuführen ist. Dr. Sonali Gnanenthiran vom George Institute, die an der Studie nicht beteiligt war, warnt: „Es ist möglich, dass Verbesserungen bei anderen Erkrankungen – etwa in der Krebsmedizin – die niedrigeren Sterberaten bei Frauen mit beeinflussen.“
Das zeigt: Die Ursachen sind komplex. Herzinfarkte geschehen nicht im Vakuum, sondern bei Menschen, die oft mehrere Erkrankungen gleichzeitig haben.
Noch ein langer Weg
Die Studie macht deutlich: Frauen werden beim Herzinfarkt nach wie vor schlechter versorgt. Sie erhalten seltener die nötigen Eingriffe, werden später diagnostiziert und haben eine höhere Sterblichkeit. Zwar verbessert sich die Situation langsam, doch die Lücke bleibt bestehen – und könnte ohne gezielte Maßnahmen noch viele Jahre brauchen, bis sie geschlossen ist.
Für die Praxis bedeutet das: Ärztinnen und Ärzte müssen Herzinfarkte bei Frauen anders denken. Atemnot, Druckgefühle oder extreme Müdigkeit sollten genauso ernst genommen werden wie die klassischen Brustschmerzen bei Männern.
Für Frauen selbst gilt: Wer ungewöhnliche Beschwerden verspürt, sollte nicht zögern, Hilfe zu suchen. Denn bei einem Herzinfarkt zählt jede Minute – und die Chancen steigen mit der Geschwindigkeit, mit der gehandelt wird.
Warum Frauen bei Herzinfarkten immer noch benachteiligt sind – und was die Forschung ändern muss
Wenn Frauen einen Herzinfarkt erleiden, verläuft ihre Behandlung oft anders als bei Männern. Noch immer erhalten sie seltener eine Angiografie oder eine Stent-Implantation (PCI) – beides entscheidende Eingriffe, um verengte oder verschlossene Gefäße wieder zu öffnen. Natürlich liegt das zum Teil an strukturellen Unterschieden in der Versorgung, doch ein weiterer Faktor spielt hinein: Frauen sind im Durchschnitt älter, wenn sie einen Herzinfarkt erleiden, und sie haben häufiger Begleiterkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck oder Demenz. Diese zusätzlichen Risiken können Ärzte verunsichern und Entscheidungen verzögern – manchmal zu Lasten der Patientinnen.
Die große Lücke in der Forschung
Kardiologin Dr. Sonali Gnanenthiran weist darauf hin, dass die Ergebnisse der aktuellen Studie nicht isoliert zu betrachten sind. Ganz im Gegenteil: Sie reiht sich ein in eine Vielzahl nationaler und internationaler Untersuchungen, die seit Jahren zeigen, dass es eine erhebliche Ungleichheit in der Behandlung von Herzinfarkten bei Männern und Frauen gibt.
Zwar gebe es ermutigende Fortschritte, doch die Kluft schließe sich zu langsam. Ein Kernproblem sei die mangelnde geschlechtsspezifische Forschung: Nur 20 bis 30 Prozent der Teilnehmer in kardiologischen Studien sind Frauen. Oft werden ihre Ergebnisse lediglich als Nebenbefund behandelt, statt in den Mittelpunkt gestellt zu werden.
„Wir brauchen dringend inklusivere Studien, flexiblere Untersuchungszeiten und digitale Formate, die Frauen den Zugang erleichtern“, betont Dr. Gnanenthiran. Erst wenn Frauen systematisch und in größerer Zahl einbezogen werden, könne man die Therapie wirklich anpassen.
Sollen Frauen andere Zielwerte haben?
Ein Beispiel, das die Diskussion auf den Punkt bringt, ist der Blutdruck. Zwar gilt er für beide Geschlechter als Risikofaktor, doch Frauen entwickeln Infarkte oder Schlaganfälle oft schon bei niedrigeren Blutdruckwerten als Männer. Das wirft eine brisante Frage auf: Brauchen Frauen eigene Richtwerte für die Vorsorge und Behandlung?
Professorin Clara Chow meint, dass genau hier die Zukunft der Kardiologie liegt. Mit mehr Forschung könnten geschlechtsspezifische Leitlinien entstehen – ein entscheidender Schritt, um Frauen präziser und sicherer zu behandeln.
Übersehene Risikofaktoren
Noch gravierender ist jedoch, dass viele frauenspezifische Risikofaktoren im Alltag kaum beachtet werden. Schwangerschaftsdiabetes, Bluthochdruck in der Schwangerschaft (Präeklampsie) oder ein frühes Einsetzen der Wechseljahre erhöhen das Risiko erheblich – und doch wird dieses Wissen im Praxisalltag oft vernachlässigt.
„Es überrascht mich immer wieder, dass Frauen mit solcher Vorgeschichte ihr eigenes Risiko unterschätzen – und dass Ärztinnen und Ärzte diese Signale ebenfalls zu selten erkennen“, sagt Chow. Dabei wäre genau hier der richtige Zeitpunkt, um frühzeitig mit Herz-Checks gegenzusteuern.
Aufklärung bleibt der Schlüssel
Beide Expertinnen machen deutlich, dass es nicht nur um High-Tech-Medizin geht. Auch die Aufklärung ist entscheidend. Frauen müssen lernen, ihre Symptome ernst zu nehmen – und Ärztinnen wie Ärzte müssen besser geschult werden, auch bei „untypischen“ Anzeichen wie Atemnot, Müdigkeit oder Rückenschmerzen einen Herzinfarkt in Betracht zu ziehen.
„Wenn wir das Bewusstsein schärfen, lassen sich Fehldiagnosen vermeiden, und mehr Frauen bekommen die lebensrettenden Untersuchungen, die sie brauchen“, erklärt Dr. Gnanenthiran.
Früher Vorsorgen – Leben retten
In Australien gibt es für bestimmte Gruppen kostenlose Herz-Checks: ab 45 Jahren, für Diabetikerinnen schon ab 35 und für indigene Bevölkerungsgruppen ab 30. Chow plädiert dafür, dass auch Frauen mit zusätzlichen Risikofaktoren – wie Schwangerschaftskomplikationen oder familiärer Vorbelastung – schon früher untersucht werden sollten.
Auch in Deutschland oder anderen europäischen Ländern ließe sich eine solche Praxis umsetzen. Denn am Ende zeigt sich immer wieder: Je früher das Herz überprüft wird, desto größer die Chance, Leben zu retten.
FAQ – Herzinfarkte bei Frauen: Versorgungslücke, Forschung & Prävention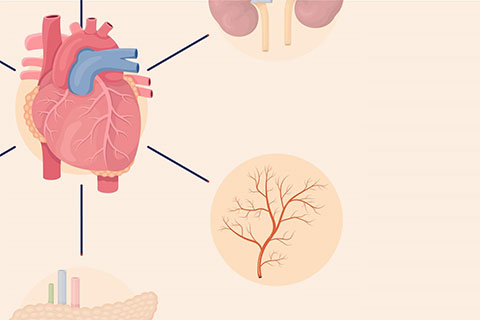
Warum werden Frauen bei Herzinfarkten oft später diagnostiziert?
Frauen zeigen häufiger „atypische“ Symptome wie Atemnot, Druck/Enge, Übelkeit, Müdigkeit oder Rücken-/Oberbauchschmerz statt des klassischen Brustschmerzes. Das führt dazu, dass Betroffene und Behandelnde die Dringlichkeit unterschätzen.
Worin unterscheidet sich die Behandlung von Frauen und Männern?
Studien zeigen niedrigere Raten an Angiografien und perkutanen Koronarinterventionen (PCI) bei Frauen. Ursache sind Versorgungsunterschiede, aber auch häufiger vorliegende Begleiterkrankungen, die Entscheidungen verzögern können.
Spielt Perfektion der Leitlinien eine Rolle – oder fehlen frauenspezifische Empfehlungen?
Frauenspezifische Leitlinien fehlen teils. Mehr geschlechtsspezifische Forschung kann klare Empfehlungen z. B. zu Diagnosewegen, Medikation und Nachsorge für Frauen ermöglichen.
Warum braucht es mehr geschlechtsspezifische Forschung?
Nur ein kleiner Anteil der Teilnehmenden in kardiovaskulären Studien sind Frauen. Ohne ausreichende Daten bleiben Diagnose- und Therapiepfade auf männliche Muster zugeschnitten.
Sollten Frauen andere Blutdruck-Zielwerte haben?
Frauen erleiden kardiovaskuläre Ereignisse häufiger schon bei niedrigeren Blutdruckwerten. Ob eigene Zielwerte nötig sind, ist Gegenstand aktueller Forschung und sollte bei Leitlinien berücksichtigt werden.
Welche frauenspezifischen Risikofaktoren werden häufig übersehen?
Schwangerschaftsdiabetes, Präeklampsie/Hypertonie in der Schwangerschaft, frühe Menopause. Diese „roten Flaggen“ erhöhen das spätere Herzinfarktrisiko und sollten zu früheren Herz-Checks führen.
Welche Rolle spielen Begleiterkrankungen?
Diabetes, Herzinsuffizienz, Demenz und andere Komorbiditäten sind bei betroffenen Frauen häufiger und können Diagnostik/Therapie erschweren. Trotz Anpassung für Komorbiditäten bleibt die Outcome-Lücke bestehen.
Was können Ärztinnen und Ärzte konkret tun?
Atypische Symptome ernst nehmen, früh EKG/Troponin, niedrige Schwelle zur Angiografie bei STEMI/NSTEMI, Risikofaktoren strukturiert erfassen (inkl. Schwangerschaftsanamnese), sekundäre Prävention und Reha aktiv anbieten.
Was können Frauen selbst tun?
Warnzeichen kennen (Atemnot, Enge, Übelkeit, ungewöhnliche Müdigkeit), früh den Notruf wählen, regelmäßige Herz-Checks einplanen – besonders bei Schwangerschaftskomplikationen, Hypertonie, Diabetes oder familiärer Belastung.
Wie lässt sich die Versorgungslücke schließen?
Mehr Awareness in Notaufnahme und Praxis, frauenspezifische Forschung und Leitlinien, inklusivere Studienrekrutierung, flexible Terminangebote, digitale Nachsorge und Qualitätsindikatoren nach Geschlecht.
Verbessern sich die Outcomes für Frauen bereits?
Ja, Sterblichkeit und schwere Ereignisse nehmen insgesamt ab, bei Frauen teils etwas schneller. Dennoch ist die Lücke noch nicht geschlossen und erfordert gezielte Maßnahmen.
Wann sollte ich einen Herz-Check machen?
Ab mittlerem Alter oder früher bei Risikofaktoren wie Hypertonie (auch in der Schwangerschaft), Diabetes, hohen Blutfetten, Rauchen, familiärer Vorbelastung sowie nach Schwangerschaftskomplikationen.
Informationsquelle: who . int