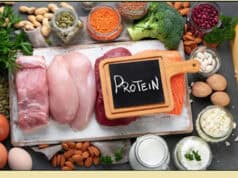Eine wachsende Debatte um hochverarbeitete Lebensmittel
Immer deutlicher zeichnen sich die Schattenseiten unserer modernen Essgewohnheiten ab. Ärzte, Ernährungswissenschaftler und Landwirte schlagen Alarm: Hochverarbeitete Lebensmittel – kurz UPF genannt – sind längst zum festen Bestandteil vieler Ernährungsweisen geworden. Doch die Folgen sind gravierend. Während in früheren Jahrzehnten das Bild des unterernährten Kindes dominierte, stehen heute Fettleibigkeit und Fehlernährung im Vordergrund. Ein aktueller UNICEF-Bericht macht es deutlich: Kinder sind inzwischen häufiger übergewichtig und gleichzeitig mangelernährt, als dass sie zu dünn wären.
Wenn viel essen nicht satt macht
Die paradox klingende Situation erklärt sich dadurch, dass stark verarbeitete Lebensmittel zwar reich an Kalorien, aber arm an Nährstoffen sind. Die Ernährungspsychiaterin Megan Lee bringt es prägnant auf den Punkt: Wer sich überwiegend von Junkfood ernährt, nimmt zwar viel zu sich, aber „es ist ernährungsphysiologisch fast so, als würde man nichts essen“. Vitamine, Mineralstoffe und Ballaststoffe fehlen. Die Folge: Trotz voller Mägen bleiben Körper und Geist hungrig nach lebenswichtigen Bausteinen.
Wie unser Geschmackssinn geprägt wird
Seit Jahrzehnten sind wir an extrem süße und salzige Produkte gewöhnt. Das hat unseren Geschmackssinn nachhaltig verändert. Frisches Obst oder Gemüse wirkt vielen Menschen fade, schlicht, wenig aufregend. Lee erklärt, dass es Zeit und bewusste Schritte braucht, um sich von dieser Überreizung zu entwöhnen und den Gaumen neu zu „kalibrieren“. Erst dann können natürliche Aromen wieder als vollwertig empfunden werden.
Das Ausmaß des Problems
Die Zahlen sind alarmierend: In Australien etwa ist bereits jedes vierte Kind im schulpflichtigen Alter übergewichtig oder adipös – rund 1,3 Millionen Kinder zwischen zwei und siebzehn Jahren. Seit 1995 ist das ein Anstieg um 20 Prozent. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, könnte im Jahr 2050 jedes zweite Kind zu schwer sein. Und das ist keine reine Frage des Körpergewichts: Fettleibigkeit geht mit einem erhöhten Risiko für Diabetes Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Gelenkprobleme und psychische Belastungen einher.
Mangelernährung trotz Überfluss
Besonders fatal ist, dass diese Kinder gleichzeitig an Mangelernährung leiden können. Denn wo Fertigprodukte, Chips und Softdrinks die Mahlzeiten dominieren, fehlen wichtige Nährstoffe, die für das Wachstum, die geistige Entwicklung und die seelische Gesundheit entscheidend sind. UNICEF warnt: Immer häufiger ersetzen diese Produkte Obst, Gemüse und proteinreiche Lebensmittel, obwohl gerade in der Kindheit eine ausgewogene Ernährung die Grundlage für ein gesundes Leben legt.
Der Ruf nach politischen Maßnahmen
Vor diesem Hintergrund werden Stimmen nach politischen Eingriffen lauter. UNICEF empfiehlt in seinem Bericht acht zentrale Maßnahmen. Dazu zählen Abgaben auf Junkfood, Subventionen für gesunde Lebensmittel, klare Lebensmittelkennzeichnungen und striktere Werberegeln, insbesondere zum Schutz von Kindern. Auch die Förderung regionaler Produkte soll eine Rolle spielen.
Eine Steuer auf Junkfood?
Eine Steuer auf hochverarbeitete Lebensmittel klingt für manche wie ein drastischer Schritt. Doch Experten wie Megan Lee argumentieren: Es gehe nicht darum, Lebensmittel künstlich zu verteuern, sondern die Einnahmen aus dieser Steuer in den Preisnachlass gesunder Lebensmittel zu investieren. So könnten Obst, Gemüse und andere frische Produkte für alle erschwinglicher werden.
Blick in andere Länder
Ein Blick über die Grenzen zeigt, dass solche Ansätze funktionieren können. In Mexiko gibt es seit Jahren eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke, die zu einem deutlichen Rückgang des Konsums geführt hat. In Großbritannien sorgte eine Softdrink-Abgabe dafür, dass Hersteller die Rezepturen änderten und den Zuckeranteil reduzierten. Beide Beispiele belegen, dass finanzielle Anreize das Verhalten von Produzenten und Konsumenten beeinflussen können.
Gesellschaftliche Verantwortung
Doch eine Steuer allein wird das Problem nicht lösen. Viele Familien greifen aus Kostengründen oder Zeitmangel zu Fertigprodukten. Deshalb braucht es ein Bündel an Maßnahmen: Aufklärungskampagnen, eine bessere Verfügbarkeit gesunder Lebensmittel, Unterstützung durch Schulen und Gemeinschaftseinrichtungen sowie Anreize für die Lebensmittelindustrie, gesündere Alternativen zu entwickeln.
Fazit: Ein Schritt in Richtung Zukunft
Die Diskussion um eine Steuer auf hochverarbeitete Lebensmittel ist nicht nur eine finanzielle, sondern auch eine gesellschaftliche Frage. Sie berührt die Gesundheit einer ganzen Generation. Kinder, die heute mit Übergewicht und Mangelernährung aufwachsen, tragen diese Belastung oft ein Leben lang mit sich. Deshalb könnte eine konsequente Steuerpolitik, flankiert von Aufklärung und Förderung gesunder Ernährung, ein entscheidender Baustein für eine bessere Zukunft sein.
Warum Bauern ganze Lebensmittel fördern wollen
Auch die Landwirte selbst sehen in der Debatte um hochverarbeitete Lebensmittel eine große Chance. Der Nationale Bauernverband (NFF) hat signalisiert, dass er eine Steuer auf UPF unterstützen würde – allerdings nur, wenn die Einnahmen sinnvoll genutzt werden. Vor allem müsse das Geld dazu dienen, die Kosten für frisches Obst, Gemüse und Nüsse zu senken und so die heimische Landwirtschaft zu stärken.
„Ein höherer Konsum von frischen Früchten, Gemüse und Nüssen liegt absolut im Interesse unserer Branche“, betonte Jolyon Burnett, Vorsitzender des NFF Horticulture Council. „Hier ergibt sich eine seltene Situation, in der das wirtschaftliche Interesse der Bauern und das gesundheitliche Wohl der Bevölkerung Hand in Hand gehen.“
UPF als billige Konkurrenz
Burnett machte gleichzeitig klar, wo das Problem liegt: Hochverarbeitete Lebensmittel lassen sich extrem günstig und in riesigen Mengen produzieren. Sie benötigen kaum frische Zutaten, noch weniger Arbeitskraft und sind daher für viele Familien oft die billigere Wahl. Diese unfaire Konkurrenz drückt nicht nur die Nachfrage nach frischen Produkten, sondern schwächt auch die Landwirtschaft, die auf hochwertige, aber arbeitsintensive Nahrungsmittel setzt.
Die Haltung der Regierung
Die australische Bundesregierung reagierte bisher zurückhaltend auf die Forderungen nach einer UPF-Steuer. Ein Sprecher stellte klar, dass aktuell keine derartigen Pläne auf dem Tisch liegen. Stattdessen verweist die Regierung darauf, dass Grundnahrungsmittel wie Obst, Gemüse und andere gesunde Produkte weiterhin von der Mehrwertsteuer befreit seien – ein finanzieller Vorteil, der den Konsum gesunder Lebensmittel fördern soll. 
Zugleich läuft bereits ein Reformprogramm im Rahmen der „Healthy Food Partnership“, das die Lebensmittelindustrie dazu anhält, den Gehalt an Zucker, Salz und gesättigten Fetten in zahlreichen Produkten zu senken. Ein weiterer Baustein ist die geplante nationale Strategie „Feeding Australia“, für deren Entwicklung die Regierung 3,5 Millionen Euro bereitstellt. Diese Strategie soll langfristig die Produktivität, Widerstandsfähigkeit und Versorgungssicherheit des australischen Ernährungssystems erhöhen.
Ein Ziel: Gesundheit und Versorgung verbinden
Die Diskussion zeigt, dass es nicht nur um Steuern und Preise geht, sondern auch um die Frage, wie ein ganzes Ernährungssystem zukunftsfähig gestaltet werden kann. Wenn eine mögliche Steuer auf hochverarbeitete Lebensmittel gleichzeitig die Landwirtschaft stärkt und der Bevölkerung gesunde Alternativen näherbringt, könnte dies tatsächlich ein doppelter Gewinn für die Gesellschaft sein.
FAQ
Warum wird über eine Steuer auf hochverarbeitete Lebensmittel (UPF) diskutiert?
Die Debatte ist eng mit der wachsenden Fettleibigkeit und Mangelernährung verbunden. Viele Menschen essen zwar viel, nehmen aber durch UPF kaum Nährstoffe zu sich. Eine Steuer könnte dazu beitragen, ungesunde Produkte weniger attraktiv zu machen und gleichzeitig gesunde Alternativen zu fördern.
Welche Vorteile sehen Bauern in einer solchen Steuer?
Landwirte betonen, dass eine Steuer Einnahmen generieren könnte, die direkt in die Förderung von Obst, Gemüse und Nüssen fließen. So würde nicht nur die Gesundheit der Bevölkerung profitieren, sondern auch die heimische Landwirtschaft gestärkt.
Wie reagiert die australische Regierung auf die Forderungen?
Die Regierung hat bislang erklärt, keine UPF-Steuer einzuführen. Stattdessen verweist sie auf Steuerbefreiungen für gesunde Grundnahrungsmittel sowie auf Programme, die Zucker, Salz und Fett in industriellen Produkten senken sollen. Außerdem wird eine nationale Ernährungsstrategie („Feeding Australia“) entwickelt.
Gibt es gesundheitliche Risiken durch UPF?
Ja. Hochverarbeitete Lebensmittel enthalten oft viel Zucker, Salz, ungesunde Fette und künstliche Zusatzstoffe, liefern aber kaum Ballaststoffe, Vitamine oder Mineralien. Auf Dauer erhöhen sie das Risiko für Übergewicht, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und psychische Belastungen.
Wären frische Lebensmittel durch eine Steuer günstiger?
Das ist das Ziel vieler Befürworter. Sie fordern, dass die Einnahmen aus einer Steuer genutzt werden, um frische Lebensmittel preislich attraktiver zu machen und damit Familien den Umstieg auf gesunde Ernährung zu erleichtern.
Informationsquelle: who . int