„Ich wachte auf und schrie vor Schmerz“ – Coopers Weg durch eine Kindheit mit chronischen Schmerzen
Ein harmloser Rempler beim Fangenspielen, neun Jahre alt, Schulhof, Knie gestoßen – nichts Besonderes. Doch wenige Tage später wachte Cooper Smylie auf und schrie vor Schmerz: ein brennendes, stechendes Dauerfeuer im rechten Fuß. Es folgten sechs Monate zwischen Notaufnahme und Hausarzt, auf der Suche nach einer Erklärung, einem Plan und jemandem, der zuhört.
Wenn Akutes bleibt: Was „chronisch“ bedeutet
Schmerz ist chronisch, wenn er länger als drei Monate anhält oder die normale Heilungszeit überschreitet. In Australien betrifft das rund 877.000 junge Menschen – etwa jedes fünfte Kind. Laut einer Befragung von 229 Betroffenen und ihren Familien beeinflusst chronischer Schmerz Schule, Freundschaften, Schlaf und psychische Gesundheit.
„Sehr individuell“ – die Spannweite des Schmerzes
Dr. Kelsi Dodds (University of Adelaide) beschreibt ein Spektrum: vom dumpfen, ziehenden Grundrauschen bis zu Schmerz, der selbst das Duschen erschwert. Für Cooper bedeutete das ohne Diagnose und Management: Er konnte zeitweise nicht mehr gehen – und fühlte sich nicht ernst genommen.
Wenn Kindern nicht geglaubt wird
Viele junge Betroffene hören, es sei „nur Angst“ (71 %) oder „Wachstumsschmerzen“ (über die Hälfte). Das erzeugt das Gefühl, sich beweisen zu müssen, während das Leben vom Unsichtbaren umgebaut wird. Cooper erlebte, dass man ihm unterstellte, er wolle Schule vermeiden – ein weiterer Schmerz neben dem körperlichen.
Kind sein am Rand
Gold Coast, Freizeitparks, Achterbahnen – für Cooper unmöglich, die Vibrationen waren zu stark. „Kleinigkeiten, von denen man nicht denkt, dass sie wehtun, taten plötzlich weh.“ Er sah seine Freunde spielen und spürte, wie sein Radius schrumpfte: „Es war mental schwer, überhaupt zu leben.“
Endlich ein Name: CRPS – später Allodynie
Nach einem halben Jahr kam die Diagnose: Complex Regional Pain Syndrome (CRPS), eine seltene Fehlregulation nach Verletzungen oder Operationen. Cooper, heute 15 und Jugendbotschafter von Chronic Pain Australia, nennt es Glück, dass die Diagnose vergleichsweise früh kam. Zwei Jahre später folgte Allodynie: harmlose Reize wie Berührung oder Luftzug lösen starken Schmerz aus.
Die lange Suche nach einem Wort
Fast zwei Drittel der Befragten warteten drei Jahre oder länger auf eine Diagnose, manche bekamen nie eine. Dr. Dodds betont das interdisziplinäre Trial-and-Error: Neurologie, Schmerzmedizin, Physio, Psychologie – bis das Bild stimmt.
Wie Schmerz den Alltag dirigiert
Chronischer Schmerz ist Tagesregie, nicht Nachmittagsprogramm. Er entscheidet, ob der Weg zur Schule machbar ist, wie viel Kraft eine Dusche kostet, ob nach dem Unterricht noch Freizeit bleibt. Er stört Schlaf, schwächt Leistungen, isoliert sozial – und zerrt an der Selbstwahrnehmung.
Energie-Budgets statt Stundenpläne
Kinder lernen, mit Energie zu haushalten: Wofür setze ich die guten Stunden ein, wo spare ich, was streiche ich, um morgen nicht zu kollabieren? Die Reaktion der Umwelt wirkt als Verstärker: Gesehen werden beruhigt, Rechtfertigung brennt aus.
Wendepunkt: Glaube und Plan
Für Cooper veränderte nicht nur das Diagnosewort alles, sondern das erste Gegenüber, das konsequent glaubte – und einen Plan schuf: Schmerztherapie, Desensibilisierung, Bewegung in kleinen Dosen, psychologische Begleitung. Der Schmerz bekam Grenzen und Rituale, die ihn handhabbarer machten.
Warum Tempo zählt
Gerade bei CRPS entscheidet früh begonnene Therapie den Verlauf. Reize dosieren, Mobilität vorsichtig steigern, Nervensystem und Psyche beruhigen – so lassen sich Schleifen durchbrechen. Allodynie reagiert auf graduelle Exposition, begleitet von Atem- und Aufmerksamkeitsübungen.
Was Familien hilft – und Schulen leisten können
Familien brauchen Wegweiser: klare Schmerzpläne, erreichbare Ansprechpersonen, realistische Physioziele, Schlaf- und Stresshygiene, Peer-Gruppen. Schulen helfen mit Flexibilität: Teilzeit-Tage, alternative Leistungsnachweise, ruhige Räume, barrierearme Wege und verlässliche Absprachen.
Ein anderer Blick auf Stärke
Stärke zeigt sich hier nicht im Sprint, sondern in tausend kleinen Entscheidungen: heute üben, morgen ruhen; Grenzen setzen; Hilfe annehmen. Diese leise Zähigkeit verdient Anerkennung, nicht Argwohn.
Ein Appell in einfachem Ton
Coopers Geschichte erinnert: Unsichtbar heißt nicht unwahr. Zuhören ist oft die erste therapeutische Handlung. Kinder müssen ihren Schmerz nicht beweisen, bevor geholfen wird. Mit Namen, Plänen und Erwachsenen, die sagen „Ich glaube dir“, wächst der Raum zum Atmen.
Schritt für Schritt zurück ins Leben
Die Schmerzen verschwinden nicht automatisch, aber sie verlieren das Monopol auf das Leben. Aus Ohnmacht wird Orientierung – und daraus die Chance, wieder Kind zu sein, trotz allem.
Unsichtbar heißt nicht eingebildet – zwei junge Menschen und ihr Alltag mit chronischen Schmerzen
Am Anfang wirkt alles harmlos: ein zwickendes Knie, eine schlechte Nacht, ein Tag, an dem der Körper einfach nicht will. Wer jung ist, macht weiter. Doch was, wenn der Schmerz bleibt – nicht Stunden, sondern Monate, Jahre? Davon erzählen Dayna Mattchewson aus Adelaide und Cooper Smylie: zwei junge Menschen, zwei Diagnosen, ein gemeinsamer Kampf darum, ernst genommen zu werden.
Ich bin nicht alt – ich habe Arthritis
Dayna war drei Jahre alt, als Ärztinnen bei ihr eine juvenile idiopathische Arthritis feststellten, eine Autoimmunerkrankung, die Entzündungen auslöst. Heute ist sie 20 und wiederholt oft: Ich habe Arthritis, aber ich bin nicht alt. Heilung gibt es nicht, sagt sie, nur Verlangsamung. Das bedeutet tägliche Planung, Vorsicht und Geduld.
Schule, Aufzug, Erklärungsnot
Dayna verpasste häufig Unterricht. Wenn sie in der Schule war, musste sie um kleine, entscheidende Anpassungen kämpfen. Fragen wie Warum nimmst du den Aufzug, du siehst doch gesund aus? trafen sie hart. Unsichtbare Krankheiten ohne Gips oder Narbe werden leicht verkannt, und das belastet die mentale Gesundheit.
Unsichtbar heißt nicht ungefährlich
Neurophysiologin Kelsi Dodds betont: Was man nicht sieht, fällt anderen schwer zu akzeptieren. Eine Befragung von Chronic Pain Australia zeigt, dass 83 Prozent der Kinder mit chronischen Schmerzen Unterricht versäumen; mehr als die Hälfte fällt fachlich zurück. Wer ständig aufholt, hat selten Energie, die eigene Situation zusätzlich zu rechtfertigen.
Wir googeln das mal – Coopers frühe Odyssee
Cooper stieß sich mit neun beim Fangenspielen das Knie. Tage später wachte er in schneidendem Schmerz auf. Monate lang pendelte die Familie zwischen Notaufnahmen und Praxen. Einmal suchte ein Arzt vor ihren Augen online nach CRPS. Heute kann Cooper darüber lachen, weil die Unterstützung besser geworden ist, doch die Szene zeigt: Zweifel statt Plan kosten Zeit.
Wenn der Schmerz einen Namen bekommt
Schließlich erhielt Cooper die Diagnose Complex Regional Pain Syndrome, eine seltene Fehlregulation nach Verletzungen oder Eingriffen. Später kam Allodynie hinzu: Berührung oder Luftzug werden zu Schmerz. Für Cooper heißt das, Energie einzuteilen und Aktivitäten zu dosieren.
Pacing, Angelvideos und Selbstschutz
Behandlung bedeutet für ihn Pacing und das kluge Einteilen von Kräften. Ein Ventil fand er im Drehen von Angelvideos. Das lenkt ab und beruhigt, sagt er. Ablenkung ist hier kein Weglaufen, sondern Selbstschutz.
Management statt Wunderheilung
Kelsi Dodds unterstreicht: Bei chronischen Schmerzen geht es oft darum, den Alltag zu managen, nicht alles zu beseitigen. Dayna stellt Pläne um, wenn Schübe kommen, erhält wöchentlich eine Biologika-Injektion gegen Entzündungen und achtet auf Grenzen, bevor der Körper sie schreit.
Sprache finden und weitergeben
Dayna schrieb einen Song über ihren Schmerz, um anderen jungen Menschen Worte zu geben. Auch ohne gleiche Diagnose können sich Menschen mit unsichtbaren Einschränkungen darin wiederfinden.
Wie Unterstützung konkret aussieht
Hilfreich ist ein Bündel kleiner, verlässlicher Maßnahmen. In der Medizin: zuhören, dokumentieren, mitdenken. In der Schule: Aufzüge und Ruhebereiche ohne Diskussion, flexible Abgaben, angepasster Sport. Zu Hause: Schlafhygiene, Pausen, Routinen. In der Psyche: Begleitung, die Gefühle sortiert, nicht nur Scores erhebt.
Gehört werden, bevor Isolation wächst
Wir dürfen nicht zulassen, dass Kinder glauben, ihr Schmerz sei normal und hinzunehmen, sagt Kelsi Dodds. Früh hinschauen, ernst nehmen und Wege ebnen verhindert, dass sich Rückzug verfestigt. Der Wille, zu helfen, ist da; die Brücke dorthin muss verlässlich sein.
Ja, es geht – aber wir spüren es immer
Dayna ist Jugendbotschafterin der Juvenile Arthritis Foundation of Australia und wünscht sich, dass Es geht nicht mit Es ist weg verwechselt wird. Wir fühlen es immer, sagt sie. Cooper ergänzt: Wenn ein Kind im Krankenhaus sagt, es hat Schmerzen, muss hingeschaut werden statt abzuwinken.
Ein anderer Blick auf Stärke
Stärke heißt nicht Zähne zusammenbeißen, sondern klug mit Energie haushalten, Hilfe annehmen, Grenzen setzen, Tage neu planen und Raum für Freude lassen. Angelvideos, Musik, Treffen mit Menschen, die verstehen, ohne viele Worte.
Schluss mit Richtung
Unsichtbar bedeutet nicht unbedeutend. Es braucht Vertrauen, Kontinuität und Anpassungen, die automatisch greifen. Wer Kindern früh glaubt, spart ihnen Kraft und gibt Zeit fürs Leben zurück. Tempo aus dem Urteil nehmen, Hürden senken, Wege ebnen: So wird aus dem Unsichtbaren ein Alltag, der wieder Platz für Zukunft lässt.
FAQ – Unsichtbare Erkrankungen & chronische Schmerzen bei jungen Menschen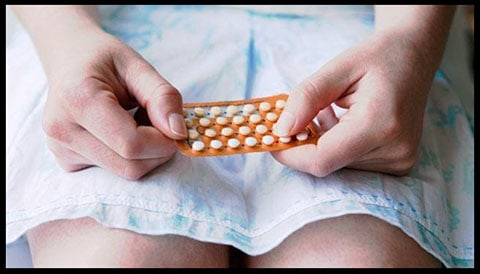
Was sind „unsichtbare“ Erkrankungen?
Krankheiten oder Einschränkungen ohne äußerlich sichtbare Zeichen (kein Gips, keine Narbe), die dennoch den Alltag stark beeinflussen, z. B. chronische Schmerzen, CRPS oder juvenile Arthritis.
Ab wann gilt Schmerz als chronisch?
Wenn er länger als drei Monate anhält oder die übliche Heilungszeit deutlich übersteigt.
Warum werden Betroffene oft nicht ernst genommen?
Weil man den Schmerz nicht sieht. Außenstehende verknüpfen Krankheit mit sichtbaren Beweisen und deuten Beschwerden fälschlich als Übertreibung, Angst oder „Wachstumsschmerzen“.
Welche Folgen haben unsichtbare Schmerzen für Schule und Alltag?
Fehlzeiten, Leistungsabfall, Einschränkungen bei Aktivitäten, sozialer Rückzug, Schlafprobleme und psychische Belastung.
Wie lässt sich chronischer Schmerz behandeln?
Meist multidisziplinär: medizinische Therapie, Schmerzmanagement, Physiotherapie, Psychologie, Schlaf- und Stresshygiene, individuelle Anpassungen in Schule und Alltag.
Heißt Behandlung, dass der Schmerz verschwindet?
Nicht immer. Ziel ist häufig, den Schmerz alltagsfähig zu managen (Pacing, Energiemanagement), statt ihn vollständig zu eliminieren.
Was ist Pacing?
Das bewusste Einteilen von Energie und Aktivitäten in kleinen, machbaren Dosen mit geplanten Pausen, um Überlastung und Rückschläge zu vermeiden.
Was ist CRPS und was bedeutet Allodynie?
CRPS ist eine Fehlregulation nach Verletzungen/OPs mit disproportionalen Schmerzen. Allodynie beschreibt Schmerzen durch eigentlich harmlose Reize wie Berührung oder Luftzug.
Welche Anpassungen helfen in der Schule konkret?
Aufzugsnutzung ohne Diskussion, flexible Abgabetermine, Ruhebereiche, angepasster Sportunterricht, Teilzeit-Tage, barrierearme Wege und feste Ansprechpersonen.
Wie können Familie und Freunde unterstützen?
Zuhören, glauben, bei Terminen helfen, Alltag entlasten, Pausen respektieren, Erfolge würdigen und gemeinsam Strategien für schwierige Tage entwickeln.
Wie spreche ich über eine unsichtbare Erkrankung?
Kurz und klar: was es ist, was es bewirkt, was heute geht und was nicht. Hilfreich sind vorbereitete Sätze und Hinweise, welche Unterstützung benötigt wird.
Wann ist schnelle Hilfe besonders wichtig?
Bei neuen, starken Symptomen, Anzeichen eines Schubs oder funktionellen Einbußen (z. B. Gehen, Sehen). Frühzeitige Abklärung kann Verschlechterungen verhindern.
Wie können Hobbys helfen?
Aktivitäten wie Musik, kreatives Arbeiten oder ruhige Outdoor-Hobbys lenken ab, strukturieren den Tag, stärken Selbstwirksamkeit und senken Stress.
Was sollten Ärztinnen und Ärzte beachten?
Beschwerden ernst nehmen, dokumentieren, interdisziplinär denken, klare Pläne vereinbaren und regelmäßig nachsteuern – ohne die Verantwortung an die Betroffenen zurückzuschieben.
Informationsquelle: who . int







