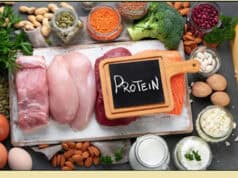Die unsichtbare Bedrohung in unserem Zuhause: Mikroplastik in der Luft, die wir atmen
Man stellt sich sein Zuhause gern als sicheren Ort vor. Als Rückzugsraum, in dem wir durchatmen, zur Ruhe kommen, uns erholen. Doch was, wenn genau das Durchatmen zur Gefahr wird? Eine aktuelle Studie, veröffentlicht im Fachjournal PLOS One, liefert beunruhigende Hinweise: Tausende Mikroplastikpartikel schweben in der Raumluft, die wir Tag für Tag einatmen – in unseren Wohnungen, Büros, Geschäften und sogar im Auto.
Diese Partikel sind so klein, dass sie nicht nur tief in die Lunge eindringen können – sie könnten dort sogar bleiben. Unsichtbar, geruchlos, unbemerkt.
Die Quelle: unser eigener Alltag
Die winzigen Kunststoffteilchen stammen offenbar aus genau den Gegenständen, die uns täglich umgeben. Teppiche, Vorhänge, Sofas, Kleidung, Autositze, Armaturenbretter – überall steckt Kunststoff, und mit der Zeit zerfällt er in mikroskopisch kleine Partikel. Diese lösen sich, werden durch Luftbewegung aufgewirbelt – und mit jedem Atemzug gelangen sie in unseren Körper.
„Die meisten Menschen verbringen rund 90 Prozent ihrer Zeit in Innenräumen“, erklären die Studienautoren Jeroen Sonke und Nadiia Yakovenko. „Und währenddessen atmen sie permanent Mikroplastik ein – meist, ohne es überhaupt zu wissen.“
Yakovenko, Umweltgeowissenschaftlerin an der Universität Toulouse, und Sonke, Forschungsdirektor am französischen Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), sprechen von einer unsichtbaren Gefahr, die gerade erst zu erforschen begonnen wird.
Die Zahlen sind alarmierend
Laut der Studie nehmen Erwachsene bis zu 68.000 Mikroplastikpartikel pro Tag durch die Raumluft auf – und zwar allein in geschlossenen Innenräumen. Das ist eine Menge, die weit über bisherigen Schätzungen liegt. Zum Vergleich: Ein rotes Blutkörperchen misst etwa 6 bis 8 Mikrometer, E. coli-Bakterien sind etwa 1 bis 2 Mikrometer lang. Viele dieser Plastikpartikel liegen genau in diesem Bereich – klein genug, um tief in Bronchien und Alveolen einzudringen.
Doch damit nicht genug: Manche Partikel sind so winzig, dass sie sogar die Blut-Luft-Schranke überwinden und in den Blutkreislauf gelangen könnten. Was das langfristig für unseren Organismus bedeutet, ist noch unklar – aber erste Hinweise lassen aufhorchen.
Mikroplastik im Körper – kein Science-Fiction mehr
Die Liste der Körperregionen, in denen Mikroplastik inzwischen nachgewiesen wurde, liest sich fast wie ein medizinischer Thriller: Lunge, Leber, Blut, Hoden, Plazenta, Gehirn, Urin, Stuhl, Muttermilch – selbst im Penisgewebe konnte Mikroplastik bereits identifiziert werden. Eine Studie vom Frühjahr 2024 ergab, dass Menschen mit Mikroplastik in den Halsschlagadern doppelt so häufig innerhalb von drei Jahren an einem Herzinfarkt, Schlaganfall oder an anderen Ursachen starben wie jene ohne entsprechende Belastung.
„Je kleiner das Partikel, desto größer der mögliche Schaden“, warnt Sherri Mason, eine der ersten Forscherinnen, die Mikroplastik in Flaschenwasser nachweisen konnten. Heute leitet sie das Projekt NePTWNE an der Gannon University und beobachtet mit Sorge, wie tief Mikroplastik bereits in den menschlichen Alltag – und Körper – eingedrungen ist.
Gesundheitsrisiken noch nicht voll erforscht – aber greifbar
Was Mikroplastik mit uns macht, ist wissenschaftlich noch nicht bis ins Detail belegt. Doch es gibt starke Hinweise auf mögliche Zusammenhänge mit:
- Atemwegserkrankungen wie chronischer Husten oder Entzündungen,
- Hormonstörungen, durch Weichmacher und andere Zusätze im Plastik,
- Neurologische Entwicklungsstörungen, insbesondere bei Ungeborenen und Kleinkindern,
- Fruchtbarkeitsproblemen und Fehlbildungen,
sowie einem erhöhten Risiko für Krebs und Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Was früher wie ein Randthema klang, wird nun zur gesamtgesellschaftlichen Herausforderung.
Branche widerspricht – doch das Bewusstsein wächst
Die Kunststoffindustrie zeigt sich indes skeptisch. Kimberly Wise White vom American Chemistry Council, einer Lobbyorganisation der Branche, kritisierte die neue Studie. Die Stichprobengröße sei zu klein, die Kontaminationsrate mit 18 % zu hoch, um verlässliche Aussagen zu treffen. Es brauche mehr Forschung, so White, mit „validierten Methoden und standardisierten Annahmen zur Belastung“.
Und doch: Die wachsende Zahl an Studien, Messungen und medizinischen Beobachtungen zeichnet ein immer klareres Bild. Eines, das schwer zu ignorieren ist.
Was können wir tun?
Auch wenn viele Ursachen strukturell bedingt sind – Verbraucher*innen haben dennoch Möglichkeiten, sich zu schützen:
– Regelmäßiges Lüften reduziert Partikelkonzentration in der Raumluft
– Staubsauger mit HEPA-Filter binden Mikroplastik besser
– Vermeidung von Kunstfasern, z. B. bei Teppichen, Kleidung oder Vorhängen
– Luftreiniger mit Feinstaubfiltern können insbesondere in Schlafräumen sinnvoll sein
Langfristig jedoch braucht es eine breitere gesellschaftliche Debatte – über unseren Umgang mit Plastik, über unsere Wohnräume, unsere Konsumgewohnheiten und darüber, wie viel uns unsere Gesundheit tatsächlich wert ist.
Wenn der Fahrzeuginnenraum zur Plastikwolke wird: Mikroplastik auf jedem Kilometer
Einsteigen, anschnallen, losfahren – das Auto ist für viele Menschen täglicher Begleiter. Es bringt uns zur Arbeit, in den Supermarkt, zu Familie und Freunden. Doch während wir Kilometer sammeln, passiert unbemerkt etwas anderes: Mit jedem Atemzug nehmen wir winzige Plastikpartikel in unsere Lunge auf. Unsichtbar, lautlos – und womöglich gesundheitlich bedenklich.
Eine neue Studie zeigt, wie stark gerade Autoinnenräume zur Mikroplastikbelastung beitragen. Während das öffentliche Bewusstsein zunehmend auf Plastikmüll in Ozeanen oder Verpackungsabfall gelenkt wird, bleibt der Blick für die unsichtbare Belastung in unserem unmittelbaren Alltag oft aus. Dabei sitzt sie – ganz wörtlich – direkt vor unserer Nase.
Das Auto: Kunststoffkapsel auf Rädern
Die Forscher um Jeroen Sonke vom Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) in Frankreich sammelten Luftproben nicht nur in ihren Wohnungen, sondern auch während Autofahrten durch französische Städte. Das Ergebnis war eindeutig – und erschreckend.
Im Durchschnitt fanden sich in einem Kubikmeter Luft im Auto rund 2.238 Mikroplastikpartikel. Zum Vergleich: In der Raumluft einer Wohnung waren es „nur“ etwa 528 Partikel pro Kubikmeter. Das bedeutet: Im Auto ist die Belastung mehr als viermal so hoch.
Warum gerade hier? Ganz einfach: Der Innenraum moderner Fahrzeuge ist vollgepackt mit Kunststoff – von Armaturenbrett über Türverkleidungen und Sitzbezüge bis zu Teppichen und Bodenmatten. All diese Materialien geben durch Reibung, UV-Licht, Temperaturwechsel und alltägliche Nutzung nach und nach winzige Partikel ab, die sich in der Luft ansammeln. Und genau diese Luft atmen wir ein – oft über Stunden hinweg.
Ein Atemzug Mikroplastik – täglich, ohne es zu merken
Laut Daten der AAA Foundation for Traffic Safety verbringen Amerikaner im Schnitt etwa eine Stunde täglich im Auto. In Europa sind es ähnlich viele Minuten. Während wir Musik hören, telefonieren oder den Stau verfluchen, atmen wir eine Mischung aus Klimaanlagenluft, Feinstaub – und unsichtbarem Mikroplastik. Das Fatale daran: Autokabinen sind kleine, geschlossene Räume mit schlechter Belüftung. Was einmal freigesetzt wird, bleibt oft in der Luft und sammelt sich an.
„Im Gegensatz zu Wohnungen oder Büros haben Fahrzeuge kaum Luftzirkulation“, erklären Studienautor*innen Sonke und Nadiia Yakovenko. „Mikroplastik kann sich hier besonders stark konzentrieren – vor allem bei langen Fahrten oder täglichem Pendelverkehr.“
Eine stille Gefahr, die uns näher ist als gedacht
„Wenn wir über Plastikverschmutzung sprechen, denken wir an Ozeane oder Fabriken“, so Sonke. „Doch unsere Ergebnisse zeigen: Die wahre Gefahr liegt oft in unserem unmittelbaren Umfeld – dort, wo wir leben, arbeiten, fahren, schlafen.“
Die Forscher*innen nutzten für ihre Analyse eine besonders präzise Technologie: Raman-Mikroskopie. Damit lassen sich Partikel bis zu einer Größe von 1 Mikrometer identifizieren. Diese feinen Teilchen waren bisher für viele Studien schlicht „unsichtbar“, da ältere Messverfahren nur Partikel ab etwa 20 Mikrometer erfassten – also rund 20-mal größer.
Der Chemieprofessor Wei Min von der Columbia University in New York, selbst Experte für Mikroskopieverfahren, lobte die Studie: „Diese Technik ermöglicht es, eine besonders kritische Größenordnung zu erfassen – eine, die bisher unter dem Radar lief, obwohl sie gesundheitlich höchst relevant sein dürfte.“
Was uns bisher entgeht: Nanoplastik
So aufschlussreich die Studie ist, sie hat auch Grenzen. Die noch kleineren Nanoplastikpartikel – also Teilchen unter 1 Mikrometer – konnten nicht erfasst werden. Diese winzigen Kunststoffsplitter, gemessen in Nanometern, sind potenziell noch gefährlicher: Sie können Zellwände durchdringen, sich in Organen einlagern und dort Stoffwechselprozesse stören.
Zum Vergleich: Ein menschliches Haar misst etwa 80.000 bis 100.000 Nanometer im Durchmesser – ein Nanoplastikpartikel ist also tausendfach kleiner. Genau diese Unscheinbarkeit macht es so gefährlich. Denn mit ihrer Winzigkeit kommt die Fähigkeit, sich nahezu ungehindert durch den Körper zu bewegen.
Was diese Partikel so bedrohlich macht
Experten wie Prof. Matthew Campen, Umwelttoxikologe an der University of New Mexico, warnen vor den gesundheitlichen Risiken dieser Kunststoffpartikel – nicht nur wegen ihrer Größe, sondern wegen ihrer chemischen Begleitstoffe. Nanoplastik kann endokrine Disruptoren wie Bisphenole, Phthalate, PFAS (auch als „ewige Chemikalien“ bekannt), Flammschutzmittel oder sogar Schwermetalle mit sich tragen. Diese Stoffe stehen im Verdacht, das Hormonsystem zu stören, die Fruchtbarkeit zu beeinflussen, das Immunsystem zu schwächen und sogar Krebs zu begünstigen.
„Diese Studie liefert wichtige Daten zur Mikroplastikbelastung“, so Campen, „aber sie zeigt auch, wie viel wir noch nicht sehen – und dringend besser messen müssen.“
Plastik vermeiden im Alltag: Kleine Schritte, große Wirkung für unsere Gesundheit
Plastik ist längst ein ständiger Begleiter unseres Alltags geworden. Ob Verpackungen im Supermarkt, To-go-Becher auf dem Weg zur Arbeit oder Folien beim Chemischen Reiniger – überall lauert Kunststoff. Doch was früher als nützlich und praktisch galt, entpuppt sich zunehmend als unsichtbare Gefahr für unsere Gesundheit und Umwelt. Mikroplastik ist nicht mehr nur ein Problem der Meere – es steckt in unserem Essen, in der Luft, die wir atmen, und sogar in unserem Blut.
Immer mehr Wissenschaftler schlagen Alarm. Einer von ihnen ist der renommierte Kinderarzt und Umweltmediziner Dr. Philipa Landrigan, der mit einem internationalen Forscherteam die gravierenden Auswirkungen von Plastik auf die menschliche Gesundheit untersucht hat. In einem umfassenden Bericht der Minderoo–Monaco-Kommission kam sein Team zu einem klaren Ergebnis: Plastik ist in jeder Phase seines Lebenszyklus gesundheitsgefährdend – von der Herstellung bis zur Entsorgung.
Plastik lässt sich nicht ganz vermeiden – aber bewusst reduzieren
Natürlich lässt sich Plastik in unserer modernen Welt nicht komplett verbannen. Geräte wie Handys, Laptops oder medizinische Ausrüstung sind ohne Kunststoff schlicht undenkbar. „Aber“, so betont Landrigan, „wir sollten uns darauf konzentrieren, das Plastik zu vermeiden, das wir nicht unbedingt brauchen – vor allem Einwegkunststoffe.“
Besonders kritisch ist der tägliche Kontakt mit Plastikverpackungen, etwa beim Aufwärmen von Lebensmitteln in der Mikrowelle. „Wenn man Plastik erhitzt, werden Mikroplastikpartikel und chemische Weichmacher freigesetzt, die direkt in die Nahrung übergehen können“, erklärt Landrigan. Der einfache Rat: Lebensmittel vor dem Erwärmen aus der Verpackung nehmen und besser in Glas oder Keramik erhitzen.
Praktische Alltagstipps für weniger Plastik – ohne großen Aufwand
Wer seine persönliche Plastikbilanz verbessern will, muss keine radikale Umstellung vollziehen. Oft reichen kleine, bewusste Veränderungen – hier ein paar Tipps, die sich leicht umsetzen lassen:
- Stoffbeutel statt Plastiktüten: Ob im Supermarkt oder auf dem Wochenmarkt – wiederverwendbare Taschen reduzieren unnötigen Müll.
- Eigener Becher fürs Café: Viele Cafés gewähren inzwischen sogar Rabatte, wenn man seinen eigenen Thermobecher mitbringt.
- Glas statt Kunststoff beim Aufbewahren: Vorratsdosen aus Glas halten länger und setzen keine Weichmacher frei.
- Metall- oder Glasflaschen für unterwegs: Plastikflaschen gehören zu den größten Quellen für Mikro- und Nanoplastik im Trinkwasser.
- Eigene Bestecksets fürs Büro: Wer eigenes Besteck mitnimmt, vermeidet täglich Einweg-Gabeln und -Löffel.
- Kleiderhülle aus Stoff für die Reinigung: Statt dünner Plastikfolie einfach eine wiederverwendbare Hülle mit Reißverschluss verwenden.
Plastik im Trinkwasser – ein wachsendes Risiko
Eine aktuelle Studie vom Januar 2024 zeigt, wie allgegenwärtig die Bedrohung durch Nanoplastik inzwischen ist: In einem Liter abgefülltem Wasser fanden Forscher im Schnitt 240.000 Plastikpartikel – fast alle davon winzig klein, für das bloße Auge unsichtbar, aber potenziell gefährlich. Solche Partikel können Zellstrukturen durchdringen und sich in Organen anreichern.
„Die Wahl einer Trinkflasche aus Glas oder Metall ist eine der einfachsten und effektivsten Möglichkeiten, sich davor zu schützen“, so Landrigan. Und wer ganz sicher gehen will, greift auf gefiltertes Leitungswasser zurück.
Politisches und gesellschaftliches Engagement wirkt
Neben individuellem Verhalten spielt auch das gesellschaftliche Engagement eine Rolle. Immer mehr Städte und Gemeinden – in den USA ebenso wie in Europa – verbieten Plastiktüten oder führen Pfandsysteme für To-go-Becher ein. „Solche Maßnahmen entstehen oft aus bürgerschaftlichem Druck heraus“, betont Landrigan. „Jede Stimme zählt.“
Jeder Schritt zählt – und jeder kann etwas tun
Niemand verlangt Perfektion. Aber das Bewusstsein für die langfristigen Folgen des Plastikkonsums wächst. Wer bereit ist, kleine Gewohnheiten zu ändern, leistet nicht nur einen Beitrag zum Umweltschutz, sondern schützt auch seine eigene Gesundheit – und die der kommenden Generationen.
FAQ
Warum ist Plastik so gesundheitsschädlich?
Plastik enthält häufig chemische Zusatzstoffe wie Weichmacher, Flammschutzmittel oder PFAS, die hormonell wirksam sein können. Besonders problematisch sind Mikro- und Nanoplastikpartikel, da sie durch Atmung, Nahrung oder die Haut in den Körper gelangen und dort Zellen, Organe oder das Hormonsystem beeinträchtigen können.
Wie kann ich im Alltag auf Plastik verzichten?
Es sind oft kleine Schritte, die viel bewirken: Wiederverwendbare Einkaufstaschen, Trinkflaschen aus Edelstahl oder Glas, Aufbewahrungsboxen ohne Kunststoff und das Vermeiden von Einwegprodukten im Alltag helfen dabei, den Plastikkonsum nachhaltig zu senken.
Sind Plastikverpackungen beim Erhitzen wirklich gefährlich?
Ja. Beim Erhitzen – etwa in der Mikrowelle – können Schadstoffe und Mikroplastikpartikel aus der Verpackung in die Nahrung übergehen. Deshalb wird empfohlen, Speisen immer in hitzebeständigen Glas- oder Keramikgefäßen zu erwärmen.
Was ist der Unterschied zwischen Mikro- und Nanoplastik?
Mikroplastik ist kleiner als 5 Millimeter, während Nanoplastik nochmals viel kleiner ist – unter 1 Mikrometer. Nanopartikel können Zellmembranen durchdringen und sich tief im Körpergewebe ablagern, was sie besonders bedenklich macht.
Wie kann ich Plastik im Trinkwasser vermeiden?
Am besten greift man zu gefiltertem Leitungswasser und vermeidet abgefülltes Wasser in Plastikflaschen. Studien zeigen, dass Flaschenwasser oft deutlich mehr Mikro- und Nanoplastik enthält als Leitungswasser.
Was kann ich in meiner Stadt gegen Plastik tun?
Engagiere dich lokal für Initiativen wie das Verbot von Plastiktüten, fördere Mehrweg-Alternativen oder unterstütze Aufklärungskampagnen. Viele Städte haben bereits Maßnahmen ergriffen – mit genügend öffentlichem Druck kann auch deine Gemeinde folgen.
Informationsquelle: who . int